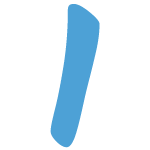UNSERE KANDIDATEN FÜR DIE WAHLEN

Nun ist es soweit!
Der Wahlkampf ist in vollem Gange und unsere Kandidaten
für die nächsten Parlamentswahlen sowie für die Europawahlen sind bereit.
Wir sind stolz darauf, von so motivierten Kandidaten vertreten zu werden, die sich für liberale Werte einsetzen!
Alle Infos zu unseren Kandidaten findet ihr hier:
WOFÜR WIR STEHEN...
Unsere Themen umfassen die Bereiche der Allgemeinen Politik, wie Bildung & Beschäftigung. Andere Themen sind – nur um ein paar zu nennen – Umwelt, Gesundheit & Soziales, Justiz, Kultur & Tourismus, Jugend & Sport, Wirtschaft sowie alles, was die Staatsreform betrifft.
EINIGE THEMEN FÜR DIE WIR UNS EINSETZEN:

MODERNISIERUNG DER REGION
Ein flächendeckendes Glasfaser Netz für Ostbelgien ist für die kommenden Jahre von großer Bedeutung. In der Ära von Homeoffice und flexibleren Arbeitsmodulen ist eine gute Netzqualität für Privathaushalte ein Muss. Für ostbelgische Unternehmen ist ein flächendeckender Glasfaser Ausbau lebensnotwendig, da Ostbelgien und seine Unternehmen sonst von den anderen Landes- oder europäischen Regionen abgehengt werden.

ATTRAKTIVE BILDUNGSOPTIONEN FÜR JUNGE MENSCHEN
Wir müssen dazu in der Lage sein unserer jungen Generation Bildungs, sowie Aus- und Weiterbildungsangebote zu bieten, die sie auf ihr zukünftiges Leben vorbereiten. Es darf keiner auf der Strecke liegen bleiben! Wir bemühen uns dafür, dass jeder die Bildungsangebote kriegt, die zu ihm/ihr am besten passen.

ARBEITSPLÄTZE IN DER PFLEGE ATTRAKTIVER GESTALTEN
Der schon bereits herrschende Fachkräftemangel in den Pflegeberufen wurde durch die Corona Pandemie verstärkt spürbar gemacht. Wir setzen uns dafür ein, dass Arbeitsplätze in der Pflege attraktiver werden, um den Fachkräftemangel zu lindern und die Pfleger zu entlasten.


KONTAKT
Möchtest Du uns schreiben, reagieren oder uns Deine Meinung mitteilen?
Kontaktiere uns einfach!

Aus technischen Gründen ist diese Webseite nicht barrierefrei zugänglich.
Wir bitten um Ihr Verständnis. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen.