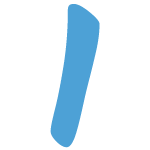UNSERE KANDIDATEN FÜR DIE WAHLEN

Nun ist es soweit!
Der Wahlkampf ist in vollem Gange und unsere Kandidaten
für die nächsten Parlamentswahlen sowie für die Europawahlen sind bereit.
Wir sind stolz darauf, von so motivierten Kandidaten vertreten zu werden, die sich für liberale Werte einsetzen!
Alle Infos zu unseren Kandidaten findet ihr hier:
UNSER FORTSCHRITTSPLAN
Die PFF hat sich nie vor ihrer Verantwortung versteckt. Wenn es einen liberalen Wert gibt, dann ist es das: Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen.
Wir wollen weiterhin für die Bürger Ostbelgiens Perspektiven schaffen! Aus diesem Grund haben wir für Sie, für unsere Region, einen Fortschrittsplan aufgestellt.
Perspektiven bringen uns in den Fortschritt, und Fortschritt bringt uns in die Freiheit!
EINIGE THEMEN FÜR DIE WIR UNS EINSETZEN:

ARBEIT MUSS SICH LOHNEN
Belgische Arbeitnehmer zahlen viel zu hohe Lohnsteuern. Durch eine Steuersenkung von 10 Milliarden € wollen wir einen Unterschied von mindestens 500 € netto pro Monat zwischen dem Berufseinkommen und dem Geld aus Sozialleistungen garantieren. Auch die zahlreichen Rentner, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, sollen besser belohnt werden.

FACHKRÄFTEMANGEL MEISTERN
Wir brauchen gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. In unseren Augen gehören die Kräfte in einem einzigen Ausbildungszentrum gebündelt. Prioritär in dieser Sache sind insbesondere das IAWM und das ZAWM. Weiche Faktoren müssen organisiert werden: z.B. müssen Kinder- und Betriebskrippen sich den Bedürfnissen der aktiven Bevölkerung anpassen und auch in Industriezonen zugänglich sein.

PFLEGESEKTOR ABSICHERN
Wir setzen uns für eine zugängliche Gesundheitsversorgung ein, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Der Erhalt unseres Pflegestandortes ist keine rein infrastrukturelle Aufgabe: Auch die Wettbewerbsfähigkeit muss verbessert werden. Gut aufgebaute Krankenhäuser und zusätzliche finanzielle Anreize: So gewinnen wir unsere Pflegekräfte zurück!

SOCIAL MEDIA FEED

KONTAKT
Möchtest Du uns schreiben, reagieren oder uns Deine Meinung mitteilen?
Kontaktiere uns einfach!

Aus technischen Gründen ist diese Webseite nicht barrierefrei zugänglich.
Wir bitten um Ihr Verständnis. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen.